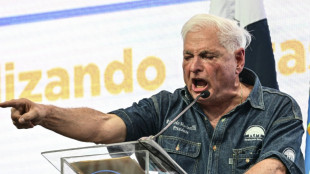Verfassungsgericht: Einsatz von Staatstrojaner nur bei schweren Straftaten zulässig
Der Einsatz sogenannter Staatstrojaner durch Strafverfolger ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nur bei schweren Straftaten zulässig. In einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss erklärten die Karlsruher Richter die Quellen-Telekommunikationsüberwachung zur Aufklärung von Straftaten mit einer Höchststrafe von maximal drei Jahren für unzulässig. Es handle sich hier um einen sehr schwerwiegenden Eingriff, weshalb dieser auf die Verfolgung besonders schwerer Straftaten beschränkt sein müsse.
Als Staatstrojaner wird eine Software bezeichnet, die die Polizei oder andere Sicherheitsbehörden heimlich auf Computer oder Handys installiert, um Verdächtige zu überwachen. Das Vorgehen ist umstritten - die nun entschiedenen Verfassungsbeschwerden kamen vom Verein Digitalcourage und wurden unter anderem von Journalisten und Rechtsanwälten unterstützt. Die klagenden Journalisten etwa fürchteten, dass bei ihnen bei beruflichem Kontakt zu Beschuldigten Überwachungssoftware installiert wird.
Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass der Einsatz der Staatstrojaner einen Eingriff in Grundrechte, der bei Straftaten mit einer drohenden Höchststrafe von maximal drei Jahren nicht gerechtfertigt sei. Es handle sich in der Gesamtschau bei der auch als Quellen-Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) bezeichneten Maßnahme um einen sehr schwerwiegenden Eingriff. Für einfache Straftaten ist die Quellen-TKÜ nach dem Beschluss nichtig. Die Vorschrift zur Ermächtigung zur Online-Durchsuchung genüge mit Blick auf das Fernmeldegeheimnis nicht dem Zitiergebot, sie gelte aber bis zu einer Neuregelung fort.
Die Quellen-TKÜ ermögliche den Zugang zu einem Datenbestand, der herkömmliche Informationsquellen an Umfang und Vielfältigkeit bei weitem übertreffen könne. Insbesondere unter den heutigen Bedingungen der Informationstechnik und ihrer Bedeutung für die Kommunikationsbeziehungen habe die Maßnahme damit "eine außerordentliche Reichweite". Angesichts der allgegenwärtigen Nutzung von IT-Systemen finde zunehmend jede Art individuellen Handelns und zwischenmenschlicher Kommunikation in elektronischen Signalen Niederschlag.
Damit dürfe dieses Mittel nur bei schweren und besonders schweren Straftaten eingesetzt werden, heißt es in der Begründung weiter. Anders als bei der Gefahrenabwehr wäre im einfachen Kriminalitätsbereich auch eine zusätzliche Qualifizierung der Straftat etwa als terroristische Straftat im Einzelfall ohne Belang, entschied das Bundesverfassungsgericht.
Die Verfassungsbeschwerde des Vereins Digitalcourage gegen die Neuregelung der Strafprozessordnung scheiterte aber über die einfachen Straftaten hinaus. Eine weitere Beschwerde des Vereins richtete sich gegen die Quellen-Telekommunikationsüberwachung im Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit Blick auf das Polizeigesetz scheiterte die Verfassungsbeschwerde, die Regelungen in Nordrhein-Westfalen seien vollständig mit dem Grundgesetz vereinbar.
W.Thakur--MT